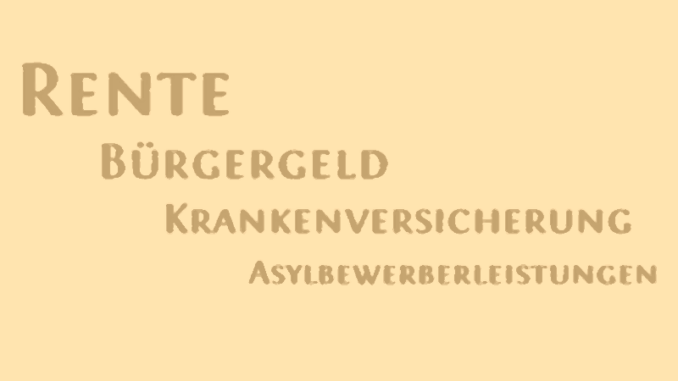
Die Finanzierung der Sozialleistungen wird immer schwieriger. Angesichts zunehmender Ausgaben, auch in anderen Bereichen, wird über Reduzierungen diskutiert. Nach Ansicht des Bundeskanzlers ist der Sozialstaat ausgeufert. Zumeist stehen in öffentlichen Diskussionen das Bürgergeld und die Asylbewerberleistungen im Fokus, obwohl das Problem viel umfassender ist.
Würden arbeitsfähige Bürgergeldempfänger weniger Geld erhalten bzw. in ein Beschäftigungsverhältnis gebracht, wären die eingesparten Summen nur verhältnismäßig klein im Vergleich zu Gesamtbelastung. Fünf Milliarden Euro könnten beim Bürgergeld eingespart werden. Das sind etwa 10 % der gesamten Bürgergeldausgaben von 50 Milliarden Euro jährlich.
Es gibt unter den Leistungsempfängern sogenannte Totalverweigerer, wie sie umgangssprachlich genannt werden, Menschen, die nur eingeschränkt arbeitsfähig sind, ihren Lebensunterhalt nicht gänzlich allein finanzieren können, und solche, die sich nicht im arbeitsfähigen Alter befinden. Zuletzt ist die Zahl der Bürgergeldempfänger durch die Zuwanderung deutlich gestiegen. Aus unterschiedlichen Gründen beziehen viele Transferleistungen.
Das Missverhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben ändert sich auch durch Leistungskürzungen nicht. Der Anteil sogenannter Arbeitsverweigerer ist relativ gering. Bei der Lösungssuche gibt es im Wesentlichen zwei Ansatzpunkte: Der politisch konservative bis rechte Teil spricht sich für Leistungskürzungen aus, der linke plädiert für Umverteilungen. Ausgangspunkt sind die unterschiedlichen Sichtweisen. Die Union verweist häufig darauf, dass Geld erst erwirtschaftet werden muss, während nach Auffassung linker und sozial orientierter Parteien genug Kapital vorhanden ist. Daraus ergeben sich unterschiedliche Schlussfolgerungen. Ein Kompromiss zwischen „es muss gekürzt und mehr gearbeitet werden” und „Reiche sollen sich stärker an den Kosten beteiligen” ist schwierig.
Obwohl Reiche viele Steuervorteile genießen, tragen sie in ihrer Gesamtheit wesentlich zum Steueraufkommen bei. Eine stärkere Belastung könnte nach Einschätzung von Experten eher zur Steuerflucht führen, und damit zu sinkenden Einnahmen. Wer der Auffassung ist, Löhne seien zu hoch besteuert, Vermögen zu gering, müsste letztere zunächst in ihrer Gesamtheit erfassen, um sie heranziehen zu können — was weitere Fragen aufwirft. Sämtliche Sachwerte wären gegenüber dem Staat anzugeben.
Auch in der Frage, ob die Ausgaben tatsächlich zu hoch sind, besteht Uneinigkeit, weil unterschiedliche Maßstäbe herangezogen werden. Die Staatsquote ist zwar gestiegen, ebenso aber auch die Wirtschaftsleistung und die Ungleichheit in der Vermögensverteilung. Mittlerweile liegt die Sozialleistungsquote bei 31 % gemessen am BIP. Länder wie Frankreich, Finnland, Österreich und Dänemark haben häufig einen noch höheren Anteil an den Sozialausgaben.
Ein noch größeres Problem ist die Finanzierung der Rente. Ab Ende der 1950er Jahre wurden mehrmals Gelder aus dem Rentensystem für Aufgaben verwendet, die nicht aus Beiträgen der Versicherten gedeckt sind, sondern einen allgemeinen Ausgleichscharakter besaßen. Es handelt sich hierbei um 520 Milliarden bis 990 Milliarden Euro. Aber allein im Jahr 2025 werden der gesetzlichen Rentenkasse voraussichtlich 121,25 Milliarden Euro als Bundeszuschüsse und steuerfinanzierte Mittel zugeführt werden müssen. Das umlagefinanzierte System wäre aufgrund der Demografie sonst nicht zu halten. Es gibt Denkansätze, das Eintrittsalter zu erhöhen, Anreize für längeres Arbeiten zu setzen und das Umlagesystem mit kapitalgedeckten Systemen zu ergänzen.
Der Ansatz, mehr Menschen in Beschäftigungsverhältnisse zu bringen, um die Sozialsysteme zu finanzieren, wird langfristig ebenfalls mit Problemen verbunden sein. Berücksichtigt werden müssen die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf die Arbeitswelt. Mit einfachen Arbeiten sind die Lebenshaltungskosten schon heute in den meisten Fällen nicht zu decken. Etabliert sich die KI in weiteren Bereichen, werden noch mehr Menschen durch Technologie ersetzt. Die nötigen Qualifizierungen müssen ebenfalls finanziert werden. Durch die KI kann sich die Zuwanderung niedrig qualifizierter Menschen zu einer weiteren Belastung für die Sozialsysteme erweisen.
Langfristige Ideen zur Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung zielen vor allem darauf ab, die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung nachhaltiger und sozial gerechter zu gestalten. Dies würde dazu führen, dass Gutverdiener stärker zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung beitragen, da derzeit Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze beitragsfrei bleiben. Zudem wird diskutiert, die Versicherungspflichtgrenze anzuheben, um mehr Gutverdiener in der gesetzlichen Krankenversicherung zu halten und den Wechsel in die private Krankenversicherung zu erschweren. Das würde die Einnahmenbasis der gesetzlichen Krankenversicherung verbreitern und auch dazu beitragen, weitere Beitragserhöhungen für die Allgemeinheit zu vermeiden.
Das Ziel der Reformen ist es, den Sozialstaat moderner, schneller, transparenter und verständlicher zu machen. Dabei sollen unter anderem Bürokratie abgebaut, Verwaltungsabläufe beschleunigt, Sozialleistungen besser aufeinander abgestimmt und digitalisiert sowie zum Teil zusammengelegt werden. Zudem sollen Erwerbsanreize verbessert werden. Die Kommission zur Modernisierung des Sozialstaats konzentriert sich zunächst auf die steuerfinanzierten Leistungen Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, Sozialhilfe. Sie sind einfacher zu reformieren als umlage- bzw. solidarisch finanzierte Systeme wie Rente, Pflege und die gesetzlichen Krankenversicherung.

Kommentar hinterlassen